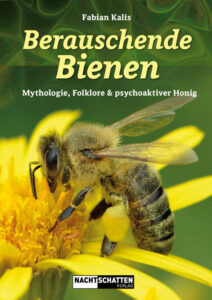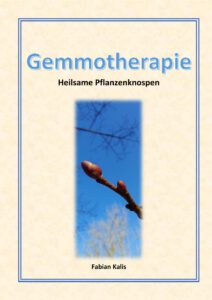Das Atlantische Hasenglöckchen (Hyacinthoides non-scripta) ist eine frühblühende Zwiebelpflanze, deren farbintensiven blauen Blüten ein eindrucksvolles Naturschauspiel bieten. Bluebell, wie die Pflanze auf englische heißt, ist vor allem auf den Britischen Inseln verbreitet. Nicht zu verwechseln ist die Pflanze mit der ebenfalls als Bluebell bezeichneten Glockenblume (Campanula spp.). Die Pflanze bildet von April bis Mai traubige Blütenstände, an denen sechs bis zwölf glockenförmige blaue Einzelblüten sitzen. Die ausdauernden Gewächse bilden dabei häufig weitreichende Pflanzenteppiche in den noch laubkargen Frühlingswäldern. Als welche der ersten Blüten im Jahr sind diese ausladenden farbenprächtigen Blütenteppiche ein erquickender Anblick. Einige britische Ortschaften sind bekannt für einen besonders bemerkenswerten Bestand dieser Pflanzen, deren Blütenpracht jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Touristen und Fotografen anlockt.

Doch das Hasenglöckchen kann nicht nur mit Schönheit aufwarten. In der traditionellen Volksheilkunde ist es eine geschätzte Heilpflanze. Hier nutzt man die im Herbst gesammelten Zwiebeln zur Behandlung von Weißfluss, als harntreibendes Mittel bei Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege sowie als blutstillende Medizin. Der klebrige Pflanzensaft wurde zudem als Klebstoff verwendet. Auch als Mittel gegen Lepra und Tuberkulose wurden die Blumenzwiebeln in der Vergangenheit eingesetzt. Darüber hinaus wurde die Pflanze als ein Zaubermittel gegen böse Alpträume und zur magischen Behandlung von Schlangenbissen verwendet. Heutzutage wird sie aufgrund der enthaltenen Pyrolizidinalkaloide jedoch häufig pauschal als giftig abgetan.

In der keltisch geprägten Kultur steht Bluebell in Verbindung mit der Welt der Feen und Geister. Die Pflanzenteppiche gelten als ein Heim dieser zauberhaften Wesenheiten. Mit dem magischen Geläute der Blüten würden Feen und Naturgeister die Menschen verzaubern, erzählen alte Geschichten. Sie ist außerdem ein Symbol für Tod und Trauer. Aus diesem Grund würden die Blütenköpfe stets in Trauer zum Boden geneigt hängen, so der Volksglaube. Auch sind die blauen Blumen eine beliebte Zierde auf Gräbern. Das Pflücken der Blüten soll Unheil oder gar den Tod bringen. Englische Bogenschützen nutzen den klebrigen Pflanzensaft, um Federn an ihre Pfeile zu kleben. Die Todessymbolik der Hasenglöckchen sollte dabei die todbringende Kraft der Pfeile magisch verstärken.
Wer umsichtig mit den magischen Blumen umgeht, kann mit ihnen aber auch auf eine positive Art mit den andersweltlichen Kräften in Verbindung treten. So heißt es, dass ein von Herzen kommender, selbstloser Wunsch, den man der ersten im Frühling erblickten Blüte anvertraut, von den dort lebenden Feen erhört und in Erfüllung gehen würde.
Text: Fabian Kalis