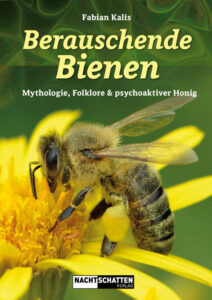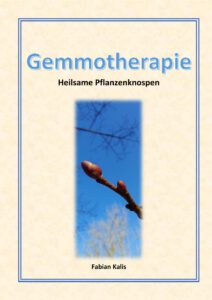Die dornenbewachsenen Rosen sind in unserer Sprache ein Sinnbild für die Dualität des seins. Alles Gute hat auch eine schlechte Seite. Fast jeder denkt bei dem Wort Dornen automatisch an die wohlduftenden Rosen. Ja, jedes Kind weiß, dass Rosen Dornen haben. Rose und Dorn bilden eine unzertrennliche Einheit in unserem Verständnis. Blöd nur, dass das leider gar nicht stimmt. Rosen haben nämlich keine Dornen.
Doch was sind diese spitzen Dinger an den Stängeln denn dann? Botanisch gesehen handelt es sich hier rum Stacheln. Ah, Stacheln, so wie bei Kakteen… Nun leider ist auch diese Behauptung nicht richtig, Kakteen haben keine Stacheln. Okay jetzt wird es verwirrend. Sprechen wir doch eindeutig von stacheligen Kakteen. Einige haben doch sogar Giftstachel? In unserem Weltbild ist ganz tief verankert: Rosen haben Dornen, Kakteen haben Stacheln. Ja sogar in einem Schulbuch meines Sohnes habe ich vor Kurzem diese falsche Aussage gefunden. (Natürlich habe ich dem Verlag sofort eine korrigierende E-Mail zukommen lassen). Doch warum gibt es diese Verwirrung, was ist eigentlich richtig und wo genau liegt der Unterschied?

Kakteen haben Dornen.

Rosen haben Stachlen.
Botanisch gesehen sind Dornen und Stacheln Bezeichnungen für verschieden geartete Pflanzenteile. Dornen sind stechende Gebilde, die aus umgewandelten Pflanzenorganen entstanden sind. Dornen stehen daher an der Stelle von Sprossachsen, Blättern oder selten auch Wurzeln. Ihre Verteilung auf der Pflanze ist daher immer regelmäßig. Dornen sind immer mit den Leitungsbahnen der Pflanzen verbunden und durchzogen. Dornen werden so mit Nährstoffen und Wasser versorgt. Man kann dies wunderbar bei den Kakteen erkennen, wo die Dornen scheinbar aus dem inneren des Kaktus kommen.

Stacheln hingegen sind zugespitzte Vorsprünge an der Sprossachse. Sie sind nicht mit den Leitungsbahnen der Pflanze verbunden. Es handelt sich um vielzellige Auswüchse an den Pflanzenorganen. Es sind keine umgewandelten Pflanzenorgane. Stacheln sind nur mit den äußeren Schichten der Pflanze verbunden und haben keine Verbindung ins Pflanzeninnere. Sie können daher leicht abgestreift werden. Dies kann man sehr gut an den Stacheln der Rosen ausprobieren. Neben den Rosen haben auch Brombeeren und Himbeeren Stacheln. Auch die Spitzen Früchte der Rosskastanie sind mit Stacheln besetzt. Dornen hingegen finden sich neben den Kakteengewächsen auch bei Schlehe, Weißdorn und Akazie.


Warum gibt es dann diese umgekehrte, falsche Verwendung in unserem alltäglichen Sprachgebrauch? Nun, es wird unseren Kindern ja sogar in der Schule falsch beigebracht. Wie kann man dann erwarten, dass Erwachsene Menschen, die sich nicht explizit für Biologie und Botanik interessieren, dieses wissen in aus Schulzeiten infrage stellen und die Wahrheit ergründen? Und die Menschen, die es eigentlich besser wissen, die ganzen Pflanzenfreunde, Botaniker und Biologen, nehmen dies viel zu oft einfach amüsiert hin, anstatt zu korrigieren. Wer will schon andere ständig auf ihre Fehler hinweisen. Nun, ich möchte, zumindest wenn es sich um ein Schulbuch handelt, welches tausenden von Kindern falsches Wissen vermittelt.

Wenn du also das nächste Mal in der Gärtnerei eine Rose kaufst, dann wende dich doch mal an den Verkäufer mit den Worten: „Entschuldigung, da sind keine Dornen an meiner Rose.“ Eine gute Gelegenheit für ein aufklärendes Gespräch.