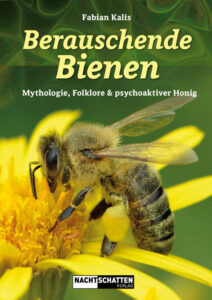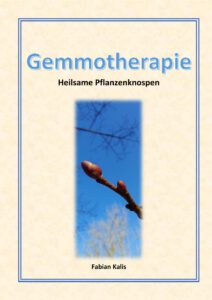Die Sehnsucht nach der Natur ist groß, gerne würdest du einfach mal rausfahren, raus aus der Stadt, weg von dem Lärm und der Hektik des modernen Getümmel, einfach mal ein verlängertes Wochenende in einer abgeschiedenen Hütte mitten im Wald an einem zauberhaften Waldsee… Ja dort könnte man mit Sicherheit ganz wunderbare Naturerfahrungen erleben. Doch wann hat man schon die Zeit dafür, mal eine paar Tage auszuspannen. Und so ein Natururlaub kostet ja auch Geld, und gegebenenfalls hast du auch Haustiere, deren Versorgung organisiert werden muss, Urlaub muss beim Arbeitgeber eingereicht und genehmigt werden und und und… Es ist so viel zu tun, für so eine kurze Zeit der Erholung. So viel zusätzlicher Stress. Dabei möchtest du doch einfach nur etwas Natur erleben. Also doch lieber ein anderes mal. Vielleicht im nächsten großen Urlaub, im nächsten Jahr, wenn die Kinder größer sind, irgendwann… Nein, so wird das wohl doch nichts im Alltag mit den Naturerfahrungen. Wie soll sich das überhaupt in einen Großstadtleben integrieren lassen. Wenn man selbst für einen kurzen Spaziergang im Wald erst eine halbe Stunde mit der U-Bahn oder dem Auto fahren muss. Wenn man umgeben ist von Beton und Stahl. Wenn man von morgens früh bis abends spät auf der Arbeit ist. Wo bleibt da die Zeit und die Möglichkeit, die Natur in den Alltag zurückzuholen?

Diese Frage stellen sich wohl viele, die zwar die Sehnsucht nach Naturanbindung haben und um die heilsamen und wohltuenden Eigenschaften von Naturerfahrungen wissen, die jedoch so stark eingebettet sind in das moderne, technische Weltbild unserer Zeit, dass der Raum für Naturerlebnisse nicht vorhanden zu sein scheint. In der Tat scheint diese Situation zunächst sehr aussichtslos. Man kann sein geordnetes und getaktetes Leben ja auch nicht einfach von heute auf morgen umkrempeln. Was tut man also nun? Welche Möglichkeiten bieten sich einem selbst in einem vollends integrierten Großstadtleben, fernab der weiten und wilden Natur? Die gute Nachricht ist: es gibt auch hier einige Übungen und Methoden, sich dennoch der Natur anzunähern. Das Geheimnis ist hierbei nur der eigene Blickwinkel. Wenn wir unsere eigene Wahrnehmung ein wenig anders ausrichten, dann stellen wir schnell fest, dass die Betonwüsten der Städte gar nicht so tot und abgeschottet von der Natur sind, wie wir uns häufig vorstellen. Wer einmal mit dem bewussten Ziel durch die Stadt spaziert, nur das pflanzliche Grün zu entdecken, welches sich seinen Weg in die Welt der Zivilisation gebahnt hat, der wird schnell feststellen, dass es auch in der größten, lautesten und hektischten Stadt überall winzige wilde Oasen gibt. Und wenn wir diesen natürlichen Ruhepolen unsere Aufmerksamkeit schenken, so merken wir, dass selbst diese kurze Achtsamkeit einen positiven Effekt auf uns hat. Die nachfolgend erläuterte Achtsamkeitsübung kann dir helfen, dir diese pflanzlichen Refugien bewusst zu machen und dich ihnen anzunähern.

Achtsamkeitsübung „Wilde Oasen wahrnehmen“
Nimm dir etwas Zeit. Bereits eine Viertelstunde genügt für diese Übung. Gerne kannst du sie aber auch zeitlich soweit ausweiten, wie es dir beliebt. Gehe durch die Stadt, nutze einen Weg, den du schon oft gegangen bist. Vielleicht deinen Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt. Doch dieses mal denke nicht an dein Ziel. Konzentriere dich zunächst auf den Moment. Nimm jeden deiner Schritte ganz bewusst wahr. Achte auf deine Atmung. Atme bewusst ein und aus. Du wirst merken, dass bereits so nach wenigen Minuten ein leichtes Entspannungsgefühl entsteht. Richte nun deinen Blick und deine Aufmerksamkeit auf deine Umwelt, versuche aber die anderen Menschen und störende Dinge wie Autos und anderen Straßenlärm auszublenden. Konzentriere dich ganz auf die Begebenheiten um dich herum. Nimm Gehwegplatten, Pflastersteine und Mauersteine wahr und suche nach Ritzen, Löchern, Ecken und Nischen. Es wird nicht lange dauern und du entdeckst irgendwo ein Pflänzlein, welches sich tapfer an einem dieser Orte angesiedelt hat.

Nun richte deine ganze Aufmerksamkeit auf diese Pflanze. Es ist hierbei völlig egal, ob du die Pflanze kennst oder nicht. Schaue die Pflanze zunächst einige Zeit an und nimm wahr, wie sie aussieht. Schaue in welcher Umgebung sie wächst. Bekommt sie dort viel Sonnenlicht? Wasser? Hat sie Platz zum Wachsen? Welche widrigen Umstände muss sie hier aushalten, um zu überleben? Autoabgase? Das Trampeln tausender Schuhsohlen? Mache dir Bewusst, dass diese Pflanze fest an diesem Ort verwurzelt ist. Sie hat keine Möglichkeit diesem Ort zu entkommen. Das hier ist ihr Lebensraum. Mit allen gegebenen Umständen. Versuche dich in die Lage der Pflanze hinein zu versetzten. Geht es ihr hier gut? Wie würdest du dich fühlen, wenn du als diese Pflanze dein ganzes Leben an diesem Ort verbringen würdest? Wäre es ein guter Ort? Konzentriere dich auf die positiven Eigenschaften, die dieser unwirkliche Lebensraum der Pflanze bietet. Vielleicht profitiert sie ja von den wärmeren Temperaturen, die in den Städten herrschen, vielleicht bekommt sie hier mehr Wasser, da sich der Regen durch die asphaltierten und betonierten Böden in großen Mengen an bestimmten Stellen zusammensammelt. Die Pflanze sie wächst und gedieht auch hier. Sie strebt nach dem Leben, vielleicht blüht sie auch gerade. Sie akzeptiert alle gegeben Umstände ohne zu beurteilen. Nähere dich der Pflanze an. Fühle ihre Blätter, rieche an ihr. Nimm wahr, welche Botschaften sie dir auf diese Weise vermittelt. Wirkt sie abwehrend? Oder eher einladend? Ist sie weich, oder eher hart und gar stachelig? Duftet sie angenehm?

Helfen ihr ihre Eigenschaften, an diesem Ort zu überstehen? Ist sie besonders robust und widerstandsfähig, oder wirkt sie eher wie ein Kontrast, der nicht an diesen Ort zu gehören scheint?
Lass die Pflanze als Ganzes noch eine Weile auf dich wirken. Versuche hierbei deine bewussten Gedankengänge loszulassen und schau, welche Gedanken sich nun von ganz alleine zeigen. Lasse jeden Gedanken zu. Nimm einfach wahr ohne die einzelnen Gedanken zu bewerten oder festzuhalten. Lasse dich treiben im Kommen und Gehen der Bilder und Worte im Kopf. Bleibe dabei jedoch stets mit deinem Fokus bei der Pflanze. Wenn dir die Zeit reif erscheint, bedanke dich bei der Pflanze für diese Begegnung und verabschiede dich. Nun kannst du dir die gemachten Empfindungen noch einmal bewusst machen. Denke darüber nach, ob du irgendwelche Erkenntnisse aus dem veränderten Blickwinkel erhalten hast und was dies für dich bedeuten kann.